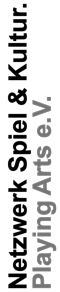Eigentlich war es so: Ich wusste auf einmal, was ich zu tun hatte. Und tat es.
Nun versuche ich in Worte zu fassen, warum ich für meine Resonanz auf die Hassmorde in Hanau eine Performance als Form wählte – und warum Playing Arts im Ernstfall trägt.
Entschluss: Ein Manifest gegen das Manifest
Als ich am 21. Februar zur Arbeit nach Hanau fahre, wird mir klar, dass ich heute ein Manifest der Liebe gegen die Manifeste des Hasses setzen will.
„Ein Manifest (lateinisch manifestus ‚handgreiflich gemacht‘) ist eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten, oftmals politischer Natur. Als Begriff der Kunst- und Literaturgeschichte auch für ästhetische Programme seit 1800 verwendet.“ (Quelle: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Manifest Zugriff am 25.2.2020) So steht´s bei Wikipedia. Manifeste bringen Dinge auf den Punkt. Sie erklären, wie die Welt sein soll. Manche poetisch, manche martialisch.
Ich habe selbst gemeinsam mit Martina Vanicek und Robby Höschele das „Playing Arts – Manifest über die Hingabe zur Kulturellen Bildung“ in die Welt gebracht. (s.u. in voller Länge) Ich versuche, danach zu leben, zum Beispiel dies: „Wenn Kultur das ist, was in unserer Gesellschaft das Menschsein offenbar werden lässt, dann müssen wir Räume schaffen, in denen der Mensch sich gestaltend offenbaren kann. Das will Playing Arts.“
Tags zuvor war ich durch Hanau gelaufen. Keine 16 Stunden nach der Tat erkannte ich Hanau nicht wieder. Eine ganze Stadt in Trauer.
Ich schrieb: „Es ist still in Hanau. Traurig. Die Menschen reden miteinander. Beim Barbier. Bei der Blumenhändlerin. Vor dem Einkaufszentrum. Ein Mann gibt jedem seiner Schritte einen Trauerton mit. Wir leben hier miteinander. In aller Verschiedenheit vertraut. #love-storm #hanauohnehass“
Da war an jeder Straßenecke, in jedem Geschäft Beziehungsgeschehen im Gange. Überall redeten Leute miteinander. Bunt gemischt. So wie Hanau eben ist. Ich wünschte mir, dass diese Hanauer Wirklichkeit gesehen wird.
Die Morde in Hanau wurde mit einem Manifest unterlegt, das auf Hass und Menschenverachtung gründet. Ich kann das so nicht stehen lassen. Ich will dieses und all die anderen Manifeste des Hasses überschreiben. Mit Liebe. Aber mir fehlen die Worte. Auch werden schon zu viele Worte gemacht, so kurz nach der Tat am 19.2.. Die ersten Politiker*innen haben die Hassmorde schon für politische Zwecke missbraucht. Die Presse sammelt markige O-Töne. An diesem Morgen wird mir innerhalb von Sekunden klar, was ich tun werde: Zwei Stühle werde ich in die Stadt tragen, ein Schild in die Hand nehmen:
#hanaumanifestoflove
Eine Kunstaktion gegen die Manifeste des Hasses
Nehmt Platz
Schaut euch in die Augen
Schweigt gemeinsam
Ich werde mich irgendwo in Hanau auf einen der Stühle setzen, den anderen mir gegenüber stellen und sehen was passiert.
Das Hanau-Manifest-der-Liebe verzichtet auf Worte. Es erklärt nichts. Es setzt Menschen in Beziehung. Zunächst mich selbst.
Performance als Ermöglichung von Resonanz
Seit 25 Jahren spiele ich als Playing Artist in und zwischen den Welten von zeitgenössischer Kunst, Biografie, Gesellschaft und in meinem Fall auch Spiritualität und evangelischer Kirche. Schon früh kristallisierte sich für mich das Performative als meine künstlerische Spur. Es ist die Ausdrucksform, die mir am besten liegt. Performance entfaltet in meiner Erfahrung eine besondere Wirkmacht, wenn und weil sie eine Öffentlichkeit erhält. Es entstehen erstaunliche Resonanzräume in mir und um mich herum zum Ort und zu den Menschen, die beteiligt sind oder Zeug*innen werden. Resonanz im Sinne von Hartmut Rosa als unverfügbares Beziehungsgeschehen. „Resonanz als Inbegriff einer gelingenden Weltbeziehung setzt die Existenz von Unverfügbarem im Sinne eines Fremden und Unerreichbaren voraus; erst auf ihrer Basis kann ein anderes hörbar werden und antworten, ohne dass die Antwort bloßes Echo oder Repetition des Eigenen ist. Resonanzfähigkeit gründet auf der vorgängigen Erfahrung und Akzeptanz von Irritierendem und nicht Angeeignetem, vor allem aber von nicht Verfügbarem, sich dem Zugriff und der Erwartung Entziehendem. In der Begegnung mit diesem Fremden setzt dann ein dialogischer Prozess der (stets partiell bleibenden) Anverwandlung ein, der die Resonanzerfahrung konstituiert.“ Quelle: ( https://www.resonanz.wien/blog/hartmut-rosa-ueber-resonanz/ Zugriff am 25.2.2020)
Die Form des Gegenübersitzens ist von Marina Abramovic inspiriert. „The Artist is Present“ im MOMA in New York war eine über viele Stunden und Wochen dauernde Übung in Präsenz, der sich die Künstlerin aussetzte. Sie war für viele, die ihr gegenüber saßen, sehr berührend. Ich vermute, dass sie sich in einer Weise gesehen fühlten, die wir sonst selten erleben. Letztes Jahr brachte die Künstlerin die Abramovic – Methode nach Frankfurt in die Alte Oper. Auch dort saßen sich Menschen gegenüber. Damals, ich gebe es zu, hatte ich keine Lust auf solch intime Begegnungen. Lieber sortierte und zählte ich Reiskörner oder ging in Zeitlupe durch den Raum.
Spielen im Ernstfall
Von Marina Abramovic und Yoko Ono habe ich gelernt, dass sich Performancekunst besonders dann kraftvoll entfaltet, wenn sie in der Form auf das wirklich Notwendige reduziert wird. Ein Mitspielen für andere wird möglich, wenn die Spielregel einfach ist. Hinsetzen, in die Augen schauen, schweigen.
- Spielen heißt, sich einer Handlung hinzugeben und sie mit aller Aufmerksamkeit zu tun.
- Spielen heißt, nicht zu wissen, was geschehen wird.
- Spielen im Playing Arts Kontext heißt, etwas wirklich zu tun, nicht „als ob“.
- Spielen heißt forschen.
- Spielen heißt, Welten zu erschaffen, die es noch nicht gibt.
Weil ich über 25 Jahre in diesem Sinne gespielt habe, kann ich mich auf diesen Stuhl setzen, ohne zu wissen, was geschehen wird. Im Sinne des Playing Arts Manifests: „Wenn Kultur das ist, was unsere Werte bewahrt, hinterfragt und weiterentwickelt, dann müssen wir Impulse setzen, die anregen, irritieren, wach machen. Das schafft Playing Arts.“ Bisher geschah zum Beispiel Folgendes:
#hanaumanifestoflove(Veröffentlicht am 23.2.20 auf meiner Facebook-Seite)
Selbst die Brüder Grimm sehen traurig aus. Das Leben am Samstagmorgen auf dem Hanauer Markt geht weiter. Der Markt wimmelt von Menschen. Man isst Bratwurst, trinkt Cappuccino, kauft Gemüse. Wie immer samstags. Doch im Minutentakt brechen Untiefen durch. Das Denkmal der Gebrüder Grimm ist Gedenkort geworden. Hier ist es still. Nur die Kinder fragen hörbar nach Blumen und Kerzen und warum. Menschen aller Hautfarben beten. Männer stehen in Paaren, reden leise und rauchen. Einer drückt seine Zigarette aus, nickt seinem Nebenmann zu. Ein Mann, ich vermute er ist Kurde, vielleicht Ende 50, blaue Jacke, Halstuch, kurze weiße Haare, raues Gesicht, unstete dunkle Augen. Er gibt sich einen Ruck, setzt sich auf den Stuhl mir gegenüber.
Ich sitze hier seit einer Stunde mit einem Schild in der Hand „#hanaumanifestoflove Eine Kunstaktion gegen die Manifeste des Hasses Nehmt Platz, schaut euch in die Augen, schweigt gemeinsam.“ Daneben steht es nochmal auf Türkisch. Ich habe gestern in meinem türkischen Stammlokal um Übersetzung gebeten. Ein Pärchen diskutierte und schrieb dann „Buyrun yer alin sadece susalin ve birbirimizin gözlerine bakalim.“
Sie bedanken sich für meine Geste.
Auch Ainur dankt mir. Ich hatte in diesen Tagen sehr an sie gedacht. Wir hatten uns Jahre nicht gesehen. Sie wollte damals eine Ausbildung in Erwachsenenbildung machen und eine Seelsorgeausbildung. Wir hatten ein paar Mal Tee getrunken, uns gleich auf einer Herzebene verstanden. Nun lässt sie sich, mit drei Blumensträußen beladen, auf dem Stuhl mir gegenüber nieder. Ich breche mein Schweigen kurz. Hatte sie gleich erkannt, trotz Kopftuch und Mantel und vollen Einkaufstaschen. Wir sitzen und schauen uns in die Augen. Um uns herum verdichtet es sich. Menschen rücken näher. Wir schauen uns an. Lächeln. „Danke, dass du hier bist! Danke!“, sagt sie und ich denke das auch. Sie schenkt mir ein gelbes Sträußchen Rosen, wir umarmen uns lachend.
Da kommt eine alte türkische Frau auf mich zu. Ihre Tochter, mit den dunklen hochgesteckten Wuschelhaaren saß vorhin lang, Tränen flossen, Ruhe verdichtete sich. Nun gibt sie der Alten einen Schubser. Sie setzt sich, klein, ernstes Gesicht, Kopftuch und brauner Mantel. Sitzt ganz still und schaut mich unverwandt an. Sitzt und sitzt. Wir atmen und schauen. Ernst. Mehr und mehr verbunden. Erneut verdichten sich Menschen, Raum und Zeit. Kameras schwenken in unsere Richtung. Ich bitte darum, das Gesicht der Frau nicht zu fotografieren. Sie bleibt und bleibt.
Es könnte nun ewig so weiter gehen. Obwohl ich hier schon lange regungslos und überwiegend schweigend sitze, tut mir nichts weh, ist mir nicht kalt. Wir teilen hier einen Raum, in dem wir uns gegenseitig Kraft geben.
Schließlich gibt sie sich einen Ruck und erhebt sich. Wir danken uns still.
Der Raum öffnet und weitet sich wieder, Menschen laufen hin und her, bringen Blumen, zünden Kerzen an, fotografieren das Blumenmeer der Trauer. Ich suche Augenkontakt. Manche verfolge ich regelrecht mit meinem Blick, lade sie mit einer Geste ein, Platz zu nehmen. Menschen, denen ich sonst niemals, niemals ins Gesicht blicken würde. All den Männern und Frauen unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe. Mit und ohne Kopftuch. Bartstoppeln, Rauschebart, Alte, Junge, Jugendliche, die aussehen, als wären sie auf Krawall gebürstet.
Sie schauen zurück, lesen mein Schild, manche lächeln, manche nicken, manche schütteln den Kopf, manche mäandern, kehren wieder um, setzen sich. „Es ist richtig, was hier steht.“, sagt einer. Nie hätte ich gedacht, dass er sich setzt. Schwarze Jeans, helle abgetragene Sportjacke, runder Kopf, weiße buschige Augenbrauen, Bartstoppeln, ein rauher Typ. Sitzt schaut mir direkt in die Augen, nickt, dankt mir, geht wieder.
Und nun sitzt dieser kurdische Mann vor mir. Ich erkenne ihn später auf einem der vielen Pressebilder wieder. Ein Angehöriger. Schon seit einer Viertelstunde sitzen wir und schweigen gemeinsam. Seine Augen sind ruhelos. Gleiten über das Denkmal, die Lichter und Schilder hinter mir, kehren kurz zurück. Plötzlich ein Moment, ein ganz kurzer Moment, in dem sich unsere Augen wirklich treffen. Ungeschützt. Eine Grenze, die wir sonst nie überschreiten würden. Weil unsere Welten nicht weiter auseinander liegen könnten.
Und während er weiter sitzt, bricht am Denkmal lautes Weinen aus. Die Verlobte eines der Männer, die aus Hass getötet wurden. Mitten in sein Herz hat der Täter geschossen. Ihre gemeinsame Zukunft zerstört. Sie ist in Deutschland nicht mehr sicher.
Der Mann und ich sitzen und sitzen, während Reporter auf der Jagd nach markigen O-Tönen sind, während Kameras kommen und gehen. Während sich Raum und Zeit verdichten und wieder öffnen, die Marktstände schließen und die ersten Männer mit Fahnen Richtung Freiheitsplatz zur 14 Uhr Demo laufen.
Am Mittwoch werde ich wieder hier sein. Mit mindestens 6 Stühlen. Wir fangen gerade erst an.
#hanau #playingarts im Ernstfall
Kunst als kleinster gemeinsamer Nenner
Ich habe bisher zwei mal ca. zwei Stunden auf dem Hanauer Markt gesessen. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich hier als Künstlerin oder als Pfarrerin sitze. Denn ich bin auch das: eine ordinierte Pfarrerin, die in der Erwachsenenbildung tätig ist. Spätestens als die verschiedensten kurdischen und türkischen Vereine ihre Fahnen auf den Freiheitsplatz zur 14 Uhr Demo trugen, als Antifa-Gruppen und Parteien Parolen auf Schildern präsentierten, war mir klar, dass ich hier auf keinen Fall eine religiöse Ebene einziehen will. Ich bin hier als Mensch, als Trauernde, als Künstlerin, mit einem starken Impuls mit anderen Menschen und Trauernden in Beziehung zu treten. Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky hat sehr weise formuliert, dass alles, was in diesen Tagen an Gedenken und Demonstrationen geplant wird, aus der Perspektive der Angehörigen zu entwickeln sei. Nur was ihnen dient, sei angemessen. Ich will also keine christlichen Deutungsangebote in die Situation eintragen. Auch wenn mich selbst mein Glaube trägt. Die Kunst ist aus meiner Sicht in der Situation in Hanau – und vermutlich auch sonst oft – der kleinste gemeinsame Nenner, der den größten Resonanzraum öffnet.
Ich weiß nichts
Ich habe durch mein Mich-aussetzen Erfahrungen gemacht, die ich sonst nie machen würde. Eine Frau saß mir 45 Minuten gegenüber. Ein kurdischer Journalist redete lange mit mir über meine Aktion und was es heißt in Deutschland multikulturell zu leben. Ich weiß nicht, was den anderen, die mir gegenüber saßen, durch den Kopf ging. Ich spürte Dankbarkeit. Ich weiß nur, dass der performative Akt mir die Möglichkeit und eine Art Schutzraum eröffnet hat, mit Menschen in Kontakt zu gehen, die ich sonst niemals, niemals auch nur annähernd angeschaut hätte. Wenn ich sage, dass wir hier gut miteinander leben, dann stimmt dass, was mich betrifft nur ein klitzekleines bisschen. Ich gehe in meinen türkischen Stammimbiss, aber die Männer, die hier essen, kenne ich nicht. Ich weiß herzlich wenig über türkische Kultur. Ich habe vergessen, wie man auf türkisch „guten Tag“ sagt. Immerhin kann ich meine Lieblingsgericht „Haslama“ korrekt aussprechen. Ich kenne genau eine türkische Frau ein klitzekleines bisschen. Ich stehe bei der Beerdigung von Ferhat auf dem Hanauer Hauptfriedhof und kenne niemanden. Ich weiß nicht, warum hier so viele Männer und so wenige Frauen sind. Ich weiß nicht, ob es normal ist, dass bei muslimischen Beerdigungen geraucht wird. Ich weiß nicht, was genau bei einer muslimischen Beerdigung passiert. Ich weiß wenig über die Geschichte der Kurden. Ich weiß nichts.
Und ich will das endlich wissen.
Playing Arts – Manifest über die Hingabe zur Kulturellen Bildung
Wenn Kultur das ist, was in unserer Gesellschaft das Menschsein offenbar werden lässt,
dann müssen wir Räume schaffen, in denen der Mensch sich gestaltend offenbaren kann.
Das will Playing Arts.
Wenn Bildung die subjektive, individuelle, unnachahmliche Aneignung von Welt ist,
dann müssen wir Welt erlebbar, begreifbar, probierbar, riskierbar machen.
Das macht Playing Arts.
Wenn Kultur das ist, was unsere Werte bewahrt, hinterfragt und weiterentwickelt,
dann müssen wir Impulse setzen, die anregen, irritieren, wach machen.
Das schafft Playing Arts.
Wenn Bildung nicht gemacht, sondern nur assistierend angeregt werden kann,
dann müssen wir anstiften statt anleiten und Selbstausdruck radikal zulassen und unterstützen.
Das kann Playing Arts.
Wenn Kultur einen sinnlichen Zugang zu Sinnfindung und Spiritualität eröffnen soll,
dann müssen wir unsere Sinne lebendig halten.
Das vollbringt Playing Arts.
Wenn Bildung ihre Prozesse nur in einem wertschätzenden Rahmen statt unter Leistungsdruck entfaltet,
dann müssen wir Resonanz mit Wertschätzung auf Augenhöhe geben.
Das bietet Playing Arts.
Wenn Kultur als soziale Plastik nur in Gemeinschaft lebendig ist,
dann müssen wir ein tragfähiges Netzwerk spannen und Dialoge verwirklichen.
Das gelingt Playing Arts.
Wenn Bildung auf Begeisterung und Vergnügen gründet,
dann müssen wir begeistern und uns begeistern lassen.
Das schafft Playing Arts.
Wenn Playing Arts Räume schafft, Welt riskierbar macht, Impulse setzt und anstiftet,
wenn Playing Arts Zugang und Rahmung bietet, ein Netzwerk spannt und begeistert,
dann müssen wir spielen.
Annegret Zander ist Playing Artist, Pfarrerin und war von 2013 – 2019 Vorsitzende des Netzwerks Spiel & Kultur. Playing Arts e.V.
Annegret Zander
annegret.zander@yahoo.de